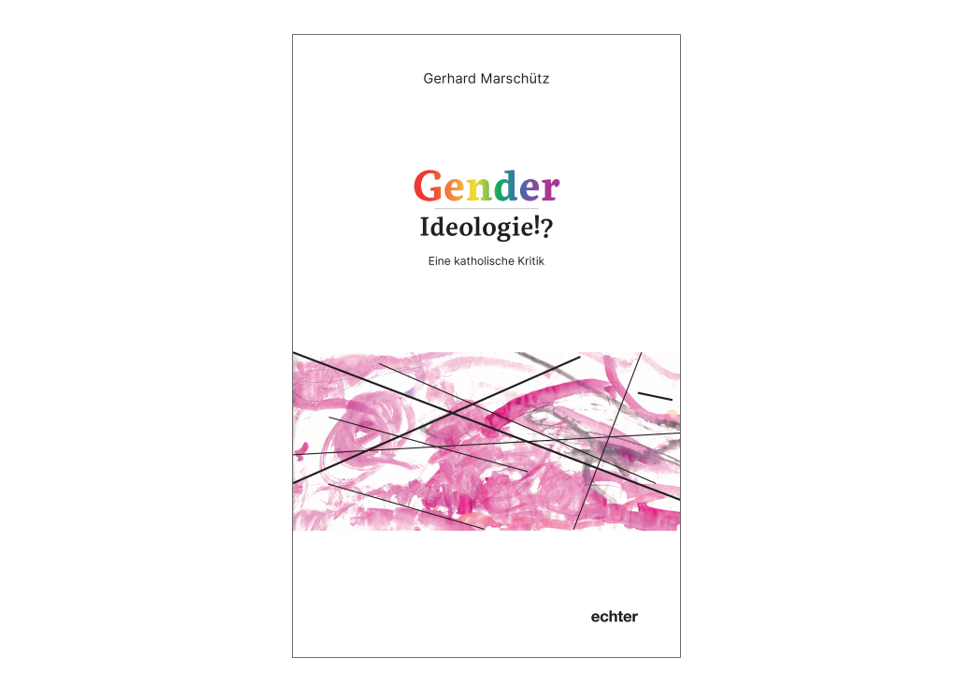
Fünf Jahre beanspruchte die Ausarbeitung der von Papst Franziskus approbierten Erklärung Dignitas infinita, die das Dikasterium für die Glaubenslehre am 8. April 2024 vorgestellt hatte. Sprachlich eigenwillig ist hier von „unendlicher Würde“ die Rede. Gemeint ist damit ein Würdeverständnis, wonach Würde allen Menschen gleichermaßen zukommt, also ausnahmslos beziehungsweise „jenseits aller Umstände“, wie es im Text heißt.
Mit „unendlich“ wird aber zudem ein ontologischer Status postuliert, den die Erklärung mit der Überzeugung verknüpft, dass die Würde letztlich in Gott gründet: „Gemäß der Offenbarung entspringt die Würde des Menschen der Liebe seines Schöpfers.“ Diese Überzeugung sei zwar auch der menschlichen Vernunft zugänglich, könne aber nur im Horizont der Offenbarung „in ihrem ganzen Umfang ans Licht treten“. Damit wird eine doppelte Argumentationslogik eröffnet.
Einerseits wird gemeinsam mit Papst Franziskus im Blick auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) bekräftigt, dass die Achtung der Würde „unverzichtbare Grundlage für die Existenz jeder Gesellschaft ist, die den Anspruch erhebt, sich auf ein gerechtes Recht und nicht auf Macht zu gründen“.
Anderseits kritisiert die Erklärung, abermals mit Verweis auf Papst Franziskus, nämlich auf dessen Neujahrsansprache vor dem Diplomatischen Korps im Vatikan am 8. Januar 2024, eine „willkürliche Vermehrung neuer Rechte“, die „oft im Widerspruch zu den ursprünglich definierten stehen“ würden. Diese Rechte entsprängen einer missbräuchlichen Verwendung des Begriffs der Menschenwürde, da sie die „konstitutiven Forderungen der menschlichen Natur“ als objektiven Bezugspunkt der menschlichen Freiheit außer Acht lassen. Konkret geht es dabei vor allem um reproduktive Rechte (Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsabbruch, Reproduktionstechnologien), ferner um das Recht, über den eigenen Tod bestimmen zu können (assistierter Suizid, Euthanasie), und schließlich um die Rechte von LGBTIQ‑Personen.
Diese neuen Rechte würden anstelle eines naturgebundenen Konzepts von Freiheit eine „abstrakte Freiheit“ behaupten, die „frei von jeglichen Bedingungen, Zusammenhängen oder Einschränkungen ist“. Eine derart reduktionistische Sicht der menschlichen Person weist die Erklärung entschieden zurück – nicht zuletzt deshalb, weil die Leugnung der fundamentalen Bedeutung der menschlichen Natur zugleich die Perspektive des von Gott gewollten Menschen als leibseelische Einheit betrifft. Nur im Licht dieser Perspektive könne die menschliche Würde vollumfänglich erkennbar werden, andernfalls wäre in vatikanischer Lesart der Vernunft nur eine verzerrte und somit unzulängliche Wahrnehmung der Menschenwürde möglich.
Menschenwürde auf katholisch schließt also immer die schöpfungstheologisch interpretierte Naturordnung ein, mithin die Würde des geschlechtlichen Körpers als Mann und Frau. „Die Würde des Leibes kann nicht als geringer angesehen werden als die der Person als solcher“, hält die Erklärung fest.
Die Geringschätzung der leiblichen Würde wird vor allem der Gender‑Theorie angelastet. Diese sei, so Papst Franziskus in der vorhin zitierten Neujahrsansprache, „sehr gefährlich, weil sie mit ihrem Anspruch, alle gleich zu machen, die Unterschiede auslöscht“. Diese Gleichmacherei auf Kosten natürlicher Unterschiede setze Würde mit einer „individualistischen Freiheit gleich“. Diese ignoriere aber, dass „das menschliche Leben in all seinen Bestandteilen, körperlich und geistig, ein Geschenk Gottes ist“, weshalb „die Gender-Theorie vorschreibt […], der uralten Versuchung des Menschen nachzugeben, sich selbst zu Gott zu machen“.
Das sind starke Worte. Zugleich sind sie vom Sinngehalt her schwach, da sie jedenfalls im wissenschaftlichen Diskurs resonanzlos verhallen. Weder gibt es die in der Erklärung kritisierte Gender‑Theorie im Singular, noch gibt es in deren Vielfalt nennenswerte Theorien, auf die zutreffen würde, den körperlichen Bestandteil menschlichen Lebens zu verkennen. Nicht um das Verkennen biologischer Unterschiede geht es, sondern um das Erkennen und Anerkennen von deren Bedeutung. In der katholischen Gender‑Kritik steht vor allem – das habe ich kürzlich detailliert in meinem Buch Gender‑Ideologie!? (Verlag Echter, 2023) dargelegt – eine erkenntnistheoretische Frage im Zentrum.
Das katholische Lehramt geht davon aus, dass die (schöpfungstheologisch begriffene) Natur von sich aus moralisch ist, also „konstitutive Forderungen“ aufweist. So betonte etwa Papst Benedikt XVI./Joseph Ratzinger wiederholt, dass „die Sprache der Natur“ auch „die Sprache der Moral“ sei und hierin Gott selbst zu achten wäre. Der Mensch sei daher „nicht nur sich selbst machende Freiheit“, sein Leben werde nur „dann recht, wenn er auf die Natur hört“. Ein solcher naturrechtlich‑essentialistischer Denkansatz prägt die katholische Geschlechteranthropologie. Doch worauf genau ist zu hören, wenn es um die menschliche Natur geht?
In den von konstruktivistischen Denkansätzen geprägten Gender Studies ist dagegen die Sprache der Moral nicht einfachhin in der Natur vorfindbar, da jede Erkenntnis der Natur nur soziokulturell vermittelt möglich ist. Jenseits des Diskursiven gibt es keinen Zugang zur Natur. Was darum im Feld des natürlich Vorgegebenen dem Menschen moralisch relevant aufgegeben ist, lässt sich nicht schon von der Natur her, sondern erst vom Menschen her mittels seiner Vernunft bestimmen. Demnach ist auch die göttliche Wahrheit nur entlang menschlicher Vermittlung erkennbar und anerkennbar, ohne dass hierin der Mensch sich zu Gott selbst machen würde.
Dieser Vernunftbestimmung unterstellt aber das katholische Lehramt, so etwa in der Enzyklika Veritatis splendor (1993), dass hierdurch die Natur alsbald zum bloßen Rohmaterial des Projekts einer individualistisch formierten menschlichen Freiheit degradiert werden würde. Obzwar eine solche Möglichkeit nie gänzlich auszuschließen ist, so ist anderseits die Anerkenntnis alternativlos, dass erkenntnistheoretisch jeder Zugriff auf die vorgegebene Realität nur perspektivisch‑konstruktional erfolgen kann. Zumal im wissenschaftlichen Kontext, der als scientific community niemals individualistisch existiert, negiert konstruktivistisches Denken nicht einfachhin vorgegebene Realität, sondern bezieht sich darauf interpretierend und hierbei auch antwortend auf beispielsweise die „Bedeutungsgebungen des Körpers“ (Judith Butler).
Wenn daher menschenrechtliche Diskurse die gleiche Freiheit aller rechtlich sichern wollen, dann besagt das hierin zum Ausdruck gelangende Gleichheitsparadigma eben nicht Gleichmacherei, sondern Anerkennung von (auch natürlich bedingter) Diversität. Der den Menschenrechten zugrunde liegende Würdebegriff impliziert die prinzipielle Gleichheit aller Menschen, ohne dadurch die Differenz und Andersheit von Individuen zu nivellieren. Prinzipielle Gleichheit (engl. equality) besagt nicht unterschiedslose Gleichheit (engl. sameness).
Der das Glaubensdikasterium prägende naturrechtlich‑essentialistische Ansatz vermag dagegen die prinzipielle Gleichheit aller Menschen nur abstrakt festzuhalten. Konkret werden nämlich Frauen von Natur aus anders als Männer markiert und LGBTIQ‑Personen gar jenseits der Naturordnung. Frauen sind daher gemäß der ihnen von Gott verliehenen Natur zwar als gleichwertig, nicht aber gleichberechtigt anzusehen. Ferner verstößt homosexuelle Praxis „gegen das natürliche Gesetz“ und ist folglich „in keinem Fall zu billigen“, wie der Katechismus festhält. Alsdann empfiehlt die Erklärung intergeschlechtlichen Menschen, entgegen heutiger medizinischer Standards, eine „Behandlung zur Behebung der Anomalien“ – wohl auch deshalb, um der angeblich schöpfungsgemäßen Geschlechterbinarität entsprechen zu können. Beim Phänomen Trans ist daher offenbar gezielt von „Geschlechtsumwandlung“ und nicht wie heute üblich von Geschlechtsangleichung oder Geschlechtsanpassung die Rede, um verdeutlichen zu können, „dass jeder geschlechtsverändernde Eingriff in der Regel die Gefahr birgt, die einzigartige Würde zu bedrohen“. Solche Aussagen bezeugen eine Ignoranz gegenüber dem modernen wissenschaftlichen Diskurs und können folglich nur mit Entsetzen zur Kenntnis genommen werden.
Wer jedenfalls so wie diese Erklärung über LGBTIQ‑Personen spricht, muss davon ausgehen, dass queere Menschen dieses Dokument nur als würdeverletzend erfahren können. Die katholisch gefasste „unendliche Würde“ findet nämlich alsbald ihre endlichen Grenzen dort, wo der vermeintliche Schöpfungsplan Gottes für Mann und Frau, speziell im Blick auf Ehe und Familie, als gefährdet angesehen wird. Warum sich das Glaubensdikasterium im Verlauf der fünfjährigen Ausarbeitungszeit der Erklärung nicht fundierter mit Gender-Theorien und hiermit verhandelter Themata auseinandergesetzt hat, bleibt ein unverständliches Rätsel, anderen erscheint es als – argumentativ kaum zu wiederlegender – Skandal. Es wäre hoch an der Zeit, dass auch die lehramtliche Theologie sich konstruktiv-kritisch an menschenrechtlichen Diskursen beteiligt und diese, speziell bei den vatikanisch gelesenen „neuen Rechten“, nicht immer wieder naturrechtlich ausbremst oder diskreditiert. Unter anderem wäre dabei zu lernen, dass es etwa im Blick auf queere Menschen nicht um die Etablierung neuer Rechte geht, sondern darum, den universalen Geltungsanspruch der bestehenden Menschenrechte für wirklich alle Menschen einzufordern. Und selbstverständlich kann seitens des Vatikans auch kritisch eingebracht werden, dass, wenn die Geltung der Grund- und Freiheitsrechte allen Menschen gleichermaßen zukommt, auch pränatale Menschen davon nicht ausgeschlossen werden können. In jedem Fall bedarf es hierfür im Diskurs überzeugender Argumente, die erkenntnistheoretisch nachvollziehbar und somit auch wissenschaftlich kommunizierbar sind. Die vom katholischen Lehramt zumeist vorgebrachten naturrechtlichen Argumente sind mehrheitlich nicht von dieser Art.
RaT-Blog Nr. 12/2024