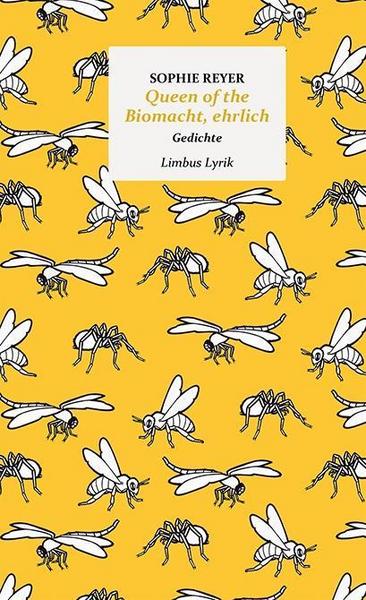

Dichtung und Gebet
Gedichte sprechen nicht primär von diesem oder jenem Gegenstand, über den sie Auskunft geben. Sie haben nicht einen partikulären Inhalt, sondern sind vielmehr ein Ganzes der Welt. Sie gestalten ein je spezifisches Verhältnis von Raum und Zeit und den Beziehungen darin. Sie bilden einen affektiven Raum (eine bestimmte Stimmung), welcher erst die Inhalte des Gedichtes trägt. Leser und Leserin können in ihn eintreten und ihn – wenigstens für Momente – bewohnen. Darin scheint eine neue Sicht von Welt auf oder vielleicht besser: Es kommt eine neue symbolische Ordnung zum Klingen. Dies führt Dichtung in die Nähe des Gebetes. Auch es eröffnet einen affektiven Raum, der von einer schöpferischen Kraft durchdrungen ist und zu einer neuen Sichtweise der Welt anleiten möchte. In beiden, Dichtung und Gebet, geht es um eine symbolische Neuschöpfung der Welt.[1]
Doppelpunkt oder das Entstehen einer neuen Welt
In beeindruckender Weise zeigt sich das im dichterischen Werk der aus Österreich stammenden Autorin, Philosophin und Komponistin Sophie Reyer. Vor allen inhaltlichen Überlegungen kann ein unscheinbares Merkmal ihres Schreibens als Hinweis darauf gelesen werden, wie im Gedicht eine neue Welt entsteht: Alle mir bekannten Texte Reyers beginnen mit einem Doppelpunkt (Kolon). Dieser geht jeder Überschrift und jedem ersten Wort voraus, bevor dieses seinen Inhalt und seine Bedeutungsvielfalt einem leeren Blatt aufprägen kann. Vor jeder konkreten Bedeutung – so ambivalent sie in der Dichtung auch sein mag – steht ein Gestus der Eröffnung: Der Doppelpunkt erweckt eine Erwartung, verbindet er doch das, was vor ihm steht, mit dem, was nach ihm zu erwarten ist.[2] Er hat stets einen mittleren Ort und kann eigentlich nicht am Anfang oder Ende eines Satzes stehen, und er kann nicht den Beginn eines Textes darstellen. Wo er dies dennoch tut, wird er zur eröffnenden Geste schlechthin. Er markiert den eröffnenden Akt, mit dem das Schreiben und Lesen einsetzt. Mit ihm entsteht eine neue Welt. In den Worten von Sophie Reyer könnte man von einem Heraustreten aus dem „selbst- Ei“, in dem wir hocken, sprechen.
:
Im selbst- Ei
hocken: noch nicht
heraus gekehrt:
Misstraue
immer dem:
Schnee?[3]
Die sieben Verse des Gedichtes enthalten vier Doppelpunkte und schließen mit einem Fragezeichen. Sie reden von der Schwierigkeit des Heraustretens in eine neue Ordnung der Bedeutungen. Ein Satz, den man, betrachtet man nur sein Wortmaterial, geneigt ist, als Imperativ zu lesen (Misstraue immer dem Schnee!), wird zum gebrochenen Fragesatz – statt dem Ruf- ein Fragezeichen; mitten im Satz ein Doppelpunkt, der den Befehlston stocken lässt; ein übermäßiger Abstand vor dem letzten Vers und ein Wechsel von links- zu rechtsbündiger Ausrichtung der Wörter. So wandelt sich der Befehl „Misstraue immer dem Schnee!“ in die vorsichtige Frage
Misstraue
immer dem:
Schnee?
Warum aber ist gerade dem Schnee zu misstrauen? Was hat es mit ihm auf sich?
Poetik des Fragilen als Poetik des Schnees
In einem ihrer theoretischen Werke bestimmt Sophie Reyer Dichtung als die „hörbare Passion im Widerstreit der Gefühle, eine Organisation von lyrischen Stimmen mit allen denkbaren Ausdrucksmitteln“.[4] Dichtung gibt jenem Widerstreit der Stimmungen, die wir nicht nur haben, sondern deren Gäste wir zuvor immer schon sind (Hans-Dieter Bahr), einen Resonanzraum. Sie gestaltet lyrische Stimmen und Stimmungen zu einem fragilen Ganzen. Sie ist Neuschöpfung einer Welt (Doppelpunkt), auf die sich jedoch nichts Verwertbares aufbauen lässt. Was entsteht, muss nicht mit aller Kraft festgehalten werden, sondern darf vergehen. Sophie Reyer bringt dies in vielen Miniaturen in ihrem Gedichtband Schnee schlafen zum Ausdruck. [5]
:
Wissen
als Wind
und wieder
verwehen[6]
Wissen ist nicht Macht, sondern führt „als Wind“ zur Anerkenntnis, dass wir keinen fixierten Standpunkt haben, von dem aus wir die Welt beurteilen könnten. Ein solcher muss „wieder / verwehen“. Liegt die „Weisheit der Flocke“, von der die Autorin in Überschriften immer wieder spricht,[7] gerade in der Verkörperung dieses fragilen Charakters des Wissens, der Erkenntnis und der Wahrnehmung?
Weisheit der Flocke IV
Nimm den Wind
in den Arm gib ihm
Recht:
von Zeit geächtet
das Gesicht neigen
als wäre es der Liebe
auf den Fersen.[8]
Erneut erweist sich, was als Befehl formuliert erscheint (Nimm den Wind in den Arm und gibt ihm Recht!), als offen. Die erste Strophe des Gedichtes endet nicht mit einem Rufzeichen, sondern mit einem Doppelpunkt: „Nimm den Wind / in den Arm gib ihm / Recht:“.
Wissen als Wind, den Wind in die Hand nehmen und ihm Recht geben – all das sind weder Befehle, die uns sagen, was wir tun müssen, noch Aussagesätze, die uns erklären, wie die Wirklichkeit beschaffen sei (nicht statisch, sondern fragil wie der Wind). Vielmehr müssen diese Aussagen, wollen sie nicht selbst Behauptungen über das Wesen der Dinge sein, etwas eröffnen: neue Horizonte der Bedeutung, der Sprache, der Wahrnehmung. Und so sagen die beiden nach dem Doppelpunkt am Ende der ersten Strophe („Recht:“) verbleibenden Strophen des Gedichtes: Was von der Logik der Zeit geächtet wird, kann zu einer kleinen Geste werden („das Gesicht neigen“), die den Sinn für die Liebe bewahrt – auch dort, wo sie nicht im Indikativ ist, sondern nur im Irrealis zu sein scheint: als wäre es der Liebe …
All die Gedichte des Bandes umkreisen das Motiv des Schnees. Er ist für Sophie Reyer wohl ein poetologischer Begriff, der etwas über das Wesen der Dichtung zum Ausdruck bringt. Er ist weiß wie eine unbeschriebene Seite; wie die Verse eines Gedichtes kann er Spuren aufnehmen, die leicht verwehen und irgendwann verschwinden; er besteht aus lauter fragilen einzelnen Elementen, den Flocken; er verweist auf den Winter als eine Sphäre, die einen großen Reichtum an Assoziationen und Verweisen entfalten kann.
„Gott“ – möglich zwischen den Zeiten?
Bleiben wir beim Bild des Winters, welcher in der Dichtung Reyers nicht allein und nicht in erster Linie Metapher für die Kälte der Welt zu sein scheint, sondern eher einen eröffnenden Charakter hat, gehen aber zu einem anderen Buch über. Die folgenden Gedichte sind dem Band Queen of the Biomacht, ehrlich, entnommen. [9]
:
wie Sonne durchs Glas scheint
ohne es zu zerstören:
deine Hand
im Herzen wühlt
es auf:
Winterrose[10]
Das Gedicht beginnt, wie wenn es ein Gleichnis präsentieren wollte: „wie Sonne durchs Glas scheint / ohne es zu zerstören:“. Statt der zu erwartenden Weiterführung durch ein „so“ (wie die Sonne … scheint, so …), folgt ein Doppelpunkt. Dieser verbindet zwar den ersten Teil des Gleichnisses mit dem Folgenden, stellt aber keine glatte Fortsetzung dar: „deine Hand / im Herzen wühlt / es auf:“ statt „so wühlt es deine Hand im Herzen auf.“ Ein Doppelpunkt, auch ans Ende dieses zweiten Teils gesetzt, macht aus diesem ein Mittelglied zwischen dem ersten Teil des Gleichnisses und dem Schlusswort „Winterrose“.
Das Durchdringen des Glases durch das Licht führt über eine Bewegtheit im Herzen („wühlt“) zum Bild der Winterrose. Das Licht vermag das Glas zu durchdringen, kommt es aber auch durch das Herz hindurch, um schließlich die Winterrose zu erleuchten? Kann die doppelte Vermittlung durch Glas und Herz schließlich in der Winterrose ihren Ruhepunkt finden oder gerät sie vorher schon ins Stocken? Immerhin kann das Wort „Winterrose“ als Stichwort für den Titel zweier weiterer Gedichte fungieren, die mit Winter 1 und Winter 2 überschrieben sind, wobei sich das erste der beiden auf der Seite neben dem Gedicht mit der Winterrose findet.
:
Winter 1
ein Schnee gefallen
immer zu früh muss man gehen
immer zu spät lernt man lieben
immer vergeblich
wie Schnee in den Händen
verblichen halt mich fest
dass der kalte Winter
(manchmal bin ich
noch alt)[11]
Der Schnee erscheint hier in Verbindung mit einer Desorientierung in der Zeit: Er ist gefallen, aber zu früh müsse man gehen und zu spät lerne man lieben. Diese Anachronie, die den Charakter des Vergeblichen hat („immer vergeblich“), herrsche „immer“, wie der Beginn dreier Verse zum Ausdruck bringt: „immer zu früh […] / immer zu spät […] / immer […]“. Die Strophe wird nicht durch einen Doppelpunkt beschlossen, sondern endet irgendwie im Nichts.
Die folgende Strophe hebt neuerlich mit einem Vergleich an, der nur stockend weitergeführt wird – „wie Schnee in den Händen / verblichen halt mich fest“ – und dessen Konsequenzen nicht mehr zur Gänze ausgesprochen werden können: „das [sodass/damit] der kalte Winter“ – hier bricht der Satz ab. Es wirkt fast so, als würde das lyrische Ich in Gedanken versinken und nicht mehr laut aussprechen, was nur mehr in Klammern geschrieben ist: „(manchmal bin ich / noch alt)“. Erneut fällt die Unzeitigkeit der beiden Verse auf: Das lyrische Ich sagt, es sei manchmal „noch alt“, anstatt zu sagen, es sei „schon alt“ oder „noch jung“. Das Gedicht endet in dieser Verwirrung der Zeiten; sein durch die Winterrose ausgelöster Titel Winter 1 vermag uns jedoch noch weiter zu leiten zu einem Gedicht mit dem Titel Winter 2. Noch ist nicht ausgeschöpft, was die Winterrose angefacht hat.
:
Winter 2
als Bläschen im Eis
von Wasser erzählen
könnte ein Gott sein
in dieser Sonne. [12]
Das erste Wintergedicht hat in eine Anachronie der Zeiten geführt. Für sich allein genommen, birgt es kein Hoffnungsmoment. Es hat jedoch unsere Fixierung auf eine lineare Folge der Zeiten gebrochen. Davon ausgehend werden wir vielleicht wachsam für eine andere Paradoxie der Zeiten, die sich in Winter 2 findet: Im Eis, dem gefrorenen Wasser, zeigen sich kleine Einschlüsse, Bläschen, die „von Wasser erzählen“ – sie sind ganz Erinnerung oder Vorausblick, niemals aber gehen sie im Jetzt, das nur Eis ist, auf. Wo die Bläschen im Eis, die von Wasser erzählen, von der Sonne beschienen sind – von der Sonne, die das Glas, das Herz und auch das Eis durchdringt, ohne sie zu zerbrechen –, taucht Gott im Gedicht auf: „könnte ein Gott sein“. Er ist nicht präsent im Indikativ, als wäre er selbst ein Teil der Welt, denn es heißt nicht „ist ein Gott“. Er ist aber auch nicht allein in der Vorstellung, als wäre er nur unsere Projektion, denn es heißt nicht, „taucht der Gedanke Gottes auf“. Vielmehr ist er präsent im Konditional: „könnte ein Gott sein“. Von Gott wird gesprochen in einer spezifischen Möglichkeitsform, die auf ein Zwischen den Zeiten (Erinnerung und Zukunft) und den Zuständen (Wasser, Eis) hindeutet.
Dichtung und Gebet
Winter 2 ist kein Gebet – die Art und Weise, wie das Gedicht Gott zwischen den Zeiten und den Zuständen erscheinen lässt, kommt aber der Sprachform der Gebete sehr nahe. Wenn ich im Anschluss daran mit der Formulierung einer Aufgabe für die Theologie schließen darf, würde ich sagen: Theologie sollte nicht immer wieder vom Gebet als Dialog zwischen Gott und Mensch sprechen, als ginge es hier einfach um zwei vorausgesetzte Partner, die miteinander reden. Sie sollte die komplexen Formen analysieren, wie in den Gebeten Gott überhaupt erst in den Zwischenräumen anklingen kann. Dadurch würde die Theologie auch in ihrer Rede von Gott ein wenig behutsamer, vorsichtiger und leiser.
Mehr zu Sophie Reyer hier und beim Löcker Verlag.
[1] Vgl. Kurt Appel: Auf der Suche nach dem Gebet, in: Rat-Blog Nr. 3/2020 (available at: https://rat-blog.at/2020/04/10/auf-der-suche-nach-dem-gebet/).
[2] Für diesen Hinweis danke ich Martin Vöhler.
[3] Sophie Reyer: Schnee schlafen. Gedichte. Wien: Löcker 2017, 80.
[4] Sophie Reyer: BioMachtBäume. Wien: Passagen Verlag 2019, 15.
[5] Sophie Reyer: Schnee schlafen. Gedichte. Wien: Löcker 2017.
[6] Reyer: Schnee schlafen, 95.
[7] Reyer: Schnee schlafen, 40, 41, 52, 81.
[8] Reyer: Schnee schlafen, 95 vgl. 33.
[9] Sophie Reyer: Queen of the Biomacht, ehrlich. Innsbruck/Wien: Limbus 2019. Wie das Wort „Biomacht“ andeutet, geht es Sophie Reyer – in den Spuren von Michel Foucault und Giorgio Agamben – auch um eine Reflexion von Machtverhältnissen, worauf wir hier nicht eingehen können. Vgl. dazu: Reyer: BioMachtBäume.
[10] Reyer: Queen of the Biomacht, ehrlich, 14.
[11] Reyer: Queen of the Biomacht, ehrlich, 15.
[12] Reyer: Queen of the Biomacht, ehrlich, 26.
Bildrechte: Löcker Verlag.
Rat-Blog Nr. 18/2021
One thought on “Poetik des Fragilen. Über die Dichtung von Sophie Reyer”
Comments are closed.